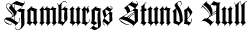Die Briten sind in Hamburg
Der Einmarsch der Engländer in Hamburg verlief komplikationslos. Viele Berichte aus jener Zeit betonen die Disziplin der Hamburgerinnen und Hamburger. „The entry was completely without incident“, vermerkt der englische General John Spurling in seinen Notizen. Die meisten Einwohner beachteten das befohlene Ausgehverbot. Jene, die sich trotzdem auf die Straße wagten, verhielten sich zumeist zurückhaltend freundlich. Die befürchteten Attacken durch unverbesserliche Nationalsozialisten blieben aus. Allerdings waren auch keine weißen Fahnen zu sehen.
Mit freundlicher Genehmigung von Spirit of Hamburg.
„Hinter der Gardine stehend sahen wir sie dann kommen“, schreibt Reinhard Reuss über den Einmarsch der Engländer in seinen im Jahr 2010 erschienenen Erinnerungen. „Langsam fuhren sie die Isestraße entlang Richtung U-Bahnstation Hoheluftbrücke. Vorweg zwei Kradfahrer mit topfförmigem Helm, umgehängter MP, Pistole im Stofffuteral, gefolgt von kleinen rasselnden Kettenfahrzeugen und Mannschaftswagen der Marke ‚Plattnase mit Ausstieg‘.“ Die Lkw’s hatten keine Motorhaube, waren also platt.
Der erste Kontakt mit den Besatzungstruppen fiel in den Stadtteilen unterschiedlich aus. „Auf der Hammer Landstraße rollten lange Kolonnen von Panzern, die ihre Geschützrohre drohend auf die Ruinen links und rechts richteten, und Militärlastwagen in die Innenstadt, begleitet von Jeeps, deren Soldaten ihre Maschinenpistolen im Anschlag hatten – ein martialisches Bild“, schreiben Uwe Bahnsen und Kerstin von Stürmer in ihrem 2004 erschienenen Buch „Die Stadt, die leben wollte“.
In Volksdorf dagegen erlebten die Einwohner, wie ein britischer Panzerspähwagen vorweg fuhr und ihm eine schottische Militärkapelle folgte. Die zwei Dutzend Musiker, die die Militärkolonne anführten, hatten ihre traditionellen weißen Kniestrümpfe und bunt gemusterte Röcke an. „Ihre Dudelsack-Musik übertönte das Motorengeräusch.“
So friedlich und freundlich diese Beschreibung klingt, so riesig waren die Probleme, vor denen die Militärregierung, der Senat und die Bevölkerung standen. „Neben der Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wasser und Lebensmittel waren vorrangig die Trümmer zu beseitigen und Wohnraum wieder herzustellen“, schreibt Hartmut Hohlbein in seinem 1985 erschienenen Buch „Hamburg 1945 – Kriegsende, Not und Neubeginn“.
Noch am Abend des 3. Mai gaben die Engländer bekannt, dass die Ausgangssperre am folgenden Tag um neun Uhr aufgehoben sei und die Geschäfte ab zehn Uhr wieder öffnen könnten. Die Engländer selbst errichteten auf der Moorweide ein Biwak und nutzten das Hotel „Vier Jahreszeiten“ als Schaltzentrale.
Bildergalerie: Die Briten sind in der Stadt – mit Maus nach links schieben
Gut zwei Wochen nach dem Einmarsch der englischen Truppen, am 15. Mai, wird das Ausgehverbot in der Hansestadt für die Zeit von 21 bis sechs Uhr festgesetzt. Zudem verbreitet, wie Hohlbein schreibt, der Sender der englischen Militärregierung – Radio Hamburg – täglich um 20 und 22 Uhr – Nachrichten. Offizielle Bekanntmachungen werden um 18.15 Uhr und 20.15 Uhr gesendet.
Das Prinzip der „indirekten Herrschaft“
So mancher Hamburger erhoffte sich auf Grund einer vielfach beschworenen Nähe zu Großbritannien eine nachsichtige Behandlung oder gar Bevorzugung durch die Engländer. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nach dem Einmarsch der englischen Truppen nicht. „Hamburg war – abgesehen von seiner Größe und seinem Hafen – grundsätzlich eine fremde Stadt wie jede andere in der britischen Besatzungszone“, schreibt der Historiker Michael Ahrens in seinem 2011 erschienenen Buch „Die Briten in Hamburg – Besatzerleben 1945-1958“.
Und so verhielt sich die Besatzungsverwaltung so, wie es die Engländer in ihren Kolonien schon erfolgreich praktiziert hatten. „In Indien, dem ‚British Raj‘, und auch in den Kolonien Afrikas hatten die Briten abgegrenzt von der einheimischen Bevölkerung nach dem Prinzip der ‚indirekten Herrschaft‘ gelebt und gearbeitet“, schreibt Ahrens. „Nach diesem Vorbild galt es nun, eine unbekannte und stark zerstörte Stadt wie Hamburg zu organisieren und letztlich mit (britischem) Leben zu füllen.“

Die Probleme kurz nach Kriegsende sind riesig: Rund eine Million Menschen leben in der zerstörten Stadt. © IWM (BU 6635)
Trotz der „indirekten Herrschaft“ sollten die Briten fast ein Jahrzehnt das Leben der Stadt entscheidend prägen und hier in einer „Parallelwelt“ leben. So wurden, wie Ahrens schreibt, erst im Mai 1951 in den S-Bahnen die Sonderabteile für Briten abgeschafft, und sogar erst 1956 die Pkw-Nummernschilder „BH“ für „Britische Zone Hamburg“ durch „HH“ ersetzt. „Die letzte britische Schule schloss 1957, im gleichen Jahr wurden die noch übrig gebliebenen beschlagnahmten Wohnungen zurückgegeben, und schließlich verließen die letzten britischen Garnisonseinheiten im Frühjahr 1958 die Stadt.“
Doch darüber dachte unmittelbar nach der Kapitulation Hamburgs niemand nach, zumal der Start der Besatzungszeit chaotisch und planlos war. „In den ersten Tagen führten kanadische Offiziere das Kommando in Hamburg“, berichtet Ahrens. „Qualifiziertes Personal fehlte in fast allen Abteilungen, und erst nach einer Woche konnte der Posten des Stadtkommandanten besetzt werden.“
So beobachtete der kommissarische Leiter der allgemeinen Staatsverwaltung, Julius Bock von Wülfingen, im Rathaus ein „Kommen und Gehen“. In den Hauptsälen im ersten Stock seien britische Büros, Passstellen und dergleichen eingerichtet worden. „Es war völlig unmöglich zu einer Verhandlung zu kommen, da man sonst stundenlang hätte warten müssen.“
Ein Problem stellten nach der Darstellung von Ahrens auch die „Vergewaltigungen, Plünderungen und Raubzüge durch britische Soldaten“ dar. „Sie fanden überwiegend direkt nach Kriegsende statt, wenn auch in weit geringerem Umfang als in anderen Besatzungszonen.“
Für wachsenden Unmut unter den Deutschen sorgte das Akquirieren von Unterkünften. „Binnen weniger Wochen beschlagnahmte das Militär eine große Zahl an Wohnungen und Gebäude, die den Grundstock für die gesamte Zeit der Besatzung bilden sollten.“ Zwar ist das gesamte Ausmaß heute nichtmehr nachvollziehbar. Aber „bevorzugt requirierten die Briten zu diesem frühen Zeitpunkt Wohnhäuser und Villen in Rotherbaum und Harvestehude sowie in Othmarschen, Blankenese und Flottbek“, schreibt Ahrens. Bei Hotels, Restaurants und Kinos war vor allem das Dreieck zwischen Rathaus, Gänsemarkt und Hauptbahnhof betroffen.
Zur Ehrenrettung der Briten muss man sagen, dass Hamburg aus ihrer Sicht eine besondere Herausforderung war. Abgesehen von ihrer Größe war das Schicksal der Hansestadt schon während des Krieges eng mit den Engländern verknüpft gewesen. „Wohl kaum eine deutsche Stadt war von britischen (und amerikanischen) Bomben so zerstört worden wie Hamburg, das bei Kriegsende noch immer eine Millionenstadt und damit die größte der Besatzungszone war.“
Auch wenn letztlich die Verlegung des Hauptquartiers der britischen Zone an die Elbe scheiterte, so war Hamburg doch Dreh-und Angelpunkt der Briten. „Die Stadt war der Importhafen aller britischen Güter. Außerdem ballten sich in keinem anderen Ort der britischen Zone so viele militärische und zivile Einheiten“, schreibt Ahrens. Von der Hamburger Musikhalle aus sendete der Soldatensender „British Forces Networks“ (BFN).
Die Wohnungsnot ist riesig
Während der Zeit des Krieges schwankte die Zahl der Bevölkerung in der Hansestadt beträchtlich. Bis 1943 sei ihre Einwohnerzahl auf Grund von Wehr- und Arbeitsdiensten um rund 150.000 Personen gesunken, schreibt der langjährige Mitarbeiter der Baubehörde, Arthur Dähn, in einem 1954 erschienenen Überblick über die Kriegsschäden in Hamburg. „Die Großangriffe im Juli 1943 bewirkten eine fluchtartige Verminderung des Bevölkerungsbestandes, und die Bevölkerungsziffer sank auf rund 800.000 Personen herab, also auf die Hälfte des Vorkriegsbestandes.“

Trotz der großen Zerstörungen in Hamburg kehren viele Flüchtlinge zurück und finden nur in Notunterkünften Unterschlupf. © IWM (BU 10918)
Allerdings kehrten nach den schweren Bombenangriffen viele Hamburger in ihre Stadt zurück, „so dass Ende des Jahres 1945 schon wieder 1,3 Millionen Einwohner in Hamburg wohnten“. Das Problem: es fehlte an allen Ecken und Enden an Wohnraum. „Während in der Vorkriegszeit im Durchschnitt 3,1 Personen je Wohnung untergebracht waren, wohnten 1946 durchschnittlich 6,5 Personen in einer Wohnung.“ Die Folgen waren „in sozialer, hygienischer, psychologischer und politischer Hinsicht“ erheblich.
Diese ohnehin schwierige Situation wurde noch dadurch verschärft, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger, die während des Krieges über das gesamte Deutsche Reich verteilt worden waren, jetzt nach Hamburg zurückströmten. Da half es auch nicht, dass die Besatzungsmächte vereinbart hatten, niemand dürfe in eine andere Besatzungszone übersiedeln. Das erhöhte nur die Zahl der Menschen, die sich illegal in Hamburg aufhielten.
Es war aber nicht nur der Mangel an Wohnraum, der die Menschen plagte. Weil große Teile Hamburgs zerstört wurden, war innerhalb der Stadt eine Unwucht entstanden. Viele Menschen mussten in den Randgebieten Hamburgs untergebracht werden. Einige – vor allem innerstädtische – Stadtteile hatten fast 100 Prozent der Bevölkerung verloren, während die ländlichen Ortsteile 100 Prozent und mehr Bevölkerungszuwachs verzeichneten.
Reinhard Reuss erlebte als Neunjähriger in der Isestraße das Ende des Krieges. Nach der Kapitulation war Hamburg „geprägt durch eine unbeschreibliche Wohnungsnot“. Ausgebombte, Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen, Schlesien, Pommern, Sudetenland suchten eine Unterkunft. Sie wurden „zunächst in Kasernen, Turnhallen, Nissenhütten und sonstigen Massenunterkünften untergebracht, sofern sie nicht mehr von den Wohnungsämtern als Untermieter in noch bestehende Wohnungen vermittelt werden konnten“.
Die heutige Max-Brauer-Allee wurde, so berichtet Reuss, in jenen Tagen „Wolldeckenallee“ genannt, weil in den Unterkünften und Kasernen die Familien sich „durch herabhängende Wolldecken voneinander abtrennten“. So gelang es ihnen, wenigstens einen Hauch von persönlicher Atmosphäre zu schaffen.
Aus heutiger Sicht ist es kaum vorstellbar, wie viele Menschen in einzelnen, zumeist kleinen Zimmern und Räumen untergebracht wurden. „Tausende Hamburger Bürger lebten unter erbärmlichsten Verhältnissen in Behelfsheimen oder als ‚Bunkermenschen‘“, schreibt Hohlbein. „Die Belegung von Räumen mit bis zu 16 Personen war durchaus keine Seltenheit.“
Die britischen Besatzungstruppen versuchten der Wohnungsnot mit der Lieferung von Baracken, den sogenannten Nissenhütten, zu begegnen. Ende 1945 lebten in derartigen Notunterkünften rund 42.000 Hamburgerinnen und Hamburger. „Das Material für diese Unterkünfte stammte aus britischen Heeresbeständen; während des Krieges waren diese Gebäude in England als Wohnraum für Wehrmachtshelferinnen verwendet worden“, schreibt Hohlbein.
In Hamburg wurden an 29 Orten Nissenhütten aufgestellt. „Sie erhielten Holz- oder Zementfußböden und wurden, wenn irgend möglich, an das Wasser- und Kanalisationsnetz der jeweiligen Straßenzüge angeschlossen.“ Hohlbein zufolge umfassten die Blocks jeweils 30 Baracken, in denen insgesamt 540 Menschen untergebracht wurden. Die Versorgung erfolgte zumeist über Gemeinschaftsküchen. „Ein Ziel der Hamburger Bauverwaltung war es, in zwei Drittel aller Nissenhütten Familien unterzubringen, wobei dann jede Baracke zwei abgeschlossene Wohnungen mit elektrischem Licht und Wasserleitung für zwei Familien haben sollte.“
Der Alltag ist von Mangel geprägt
Uwe Bahnsen und Kerstin von Stürmer beschreiben die Stimmungslage in Hamburg in den ersten Tagen und Wochen nach der Kapitulation als ambivalent. „Einerseits war jedermann zutiefst erleichtert darüber, den Krieg überlebt zu haben und nachts endlich wieder schlafen zu können, ohne durch heulende Sirenen geweckt zu werden.“ Andererseits herrschte Unsicherheit und Zukunftsangst – der psychische Druck, der auf den meisten Hamburgerinnen und Hamburgern lastete, war enorm. „Der tägliche Existenzkampf forderte jeden Einzelnen in einem heute nur schwer nachvollziehbaren Ausmaß, denn die staatliche Daseinsvorsorge war zertrümmert wie die ganze Stadt.“
Der Alltag der Menschen war zudem von Mangel geprägt. Zwar litten die Menschen unmittelbar nach Kriegsende (noch) nicht an Hunger, auch weil Gauleiter Karl Kaufmann und Kampfkommandant Alwin Wolz in den letzten Apriltagen die Lebensmittellager geöffnet hatten. Aber beispielsweise Holz, das man zum Kochen oder später zum Heizen benötigte, wurde häufig – unter nicht geringer Gefahr für das eigene Leben – aus zerstörten Wohngebäuden geholt.
„Unsere Suche nach Holz und möglicherweise Koks aus verschütteten Heizungskellern war aus zweierlei Gründen nicht ungefährlich: 1. Die Trümmer konnten jederzeit einstürzen. 2. Große Gefahr ging von eventuell noch vorhandenen Blindgängern aus,“ schreibt Reinhard Reuss in seinen Erinnerungen.
Hinzu kam, dass Holz nicht einfach so in der Gegend herumlag. „Teilweise mussten angekohlte Türrahmen aus dem Mauerwerk gebrochen werden, auch waren lange verkohlte Holzbalken, auf denen ursprünglich die Fußböden der einzelnen Etagen ruhten, eine heiß begehrte Beute.“ Manchmal wurden die Menschen auf dem Balkon oder im Keller fündig. „Eine Plage waren die von uns Kindern gefürchteten Ratten in den Trümmern und insbesondere in der Nähe des Isebekkanals.“
Vor allem öffentliche Parks wie das Niendorfer Gehege waren gefährdet. „Hier traten die Erwachsenen in Aktion.“ Mit Axt und Säge gingen sie vor allem in der Dämmerung daran, Sträucher abzuhacken oder ganze Bäume zu fällen.
Der Kohleklau
Auch der Diebstahl von Kohle gehörte zum Alltag. „Ganz Mutige“ lauerten den Kohletransporten der Reichsbahn auf, wie Reuss schreibt. „So zum Beispiel auf der sogenannten Verbindungsbahn zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und dem Bahnhof Altona – insbesondere auf dem Streckenabschnitt Lombardsbrücke und Sternbrücke.“ Immer wenn ein Zug vor einem Rotsignal halten musste, kletterten – zumeist sind es Jungen – auf die Waggons und warfen die Kohle zum Aufsammeln hinunter. „Häufig waren die Züge von englischen Soldaten bewacht, so dass der Gebrauch von Schusswaffen nicht auszuschließen war.“
Eine andere Möglichkeit, an Kohlen zu kommen, boten Schuten auf dem Isebekkanal. Diese waren oft mit Anthrazitkohle beladen. „Sie wurden bei ‚Meincke & Hertz‘ angelandet und dümpelten bis zur Entladung für die Engländer und die Krankenhäuser leicht zugänglich auf dem Kanal herum“, schreibt Reuss. „Bei mehreren Schuten war es häufig so, dass diese am gegenüberliegenden – also unserem – Ufer lagen und daher noch leichter zu ‚entern‘ waren.“
Die deutsche Schutenwache wurde dabei mit Zigaretten oder Alkohol bestochen. „Der Wachhabende, der ohne großen Scharfsinn den Grund unserer Visite begriff, verschwand in einer Art kleinen Kajüte im Vorschiff, um die Tauschware zu verstauen und ‚um mal nach dem Ofen zu schauen‘“, berichtet Reuss. „Jetzt war Eile geboten: Wir warfen richtige Anthrazitblöcke ans Ufer und stopften Taschen und Beutel mit kleineren Stücken voll.“ Daheim wurde nach der Herkunft der Kohle vorsichtshalber nicht gefragt.
Die heute 80-jährige Margot Brügmann erinnert sich noch sehr gut an ihre Kindheit und ihre Jugend, die sie in der Jarrestadt verbrachte. „Aus der Zeit nach Kriegsende ist mir vor allem in Erinnerung geblieben, dass wir endlich durchschlafen konnten.“ Hinzu kam der Einfallsreichtum, mit dem die Menschen versuchten, ihre Not zu lindern. „Es war normal, auf seinem Balkon Gänse, Hühner oder Kaninchen zu halten.“ Normal waren auch die drei mal vier Meter großen Beete in den Innenhöfen. Wer Parterre wohnte, hatte Glück. Er konnte das Fleckchen Erde umpflügen und mit Wurzeln, Tomaten, Kohlrabi oder Kartoffeln bepflanzen.
„Mehr als einmal kam es leider vor, dass in der Nacht die Ernte gestohlen wurde“, erzählt Margot Brügmann. Einmal wurde dabei ein mächtiger Stiefelabdruck hinterlassen. „Alle ahnten, dass es der Schutzmann gewesen war.“ Die Früchte, die ihr Vater anbaute, waren da weniger gefährdet. „Er züchtete auf der Fensterbank Tabak, und wenn er die Blätter fermentierte, stank das immer gewaltig in unserer Wohnung.“
Andere Städter versuchten ihr Glück bei den Bauern im Hamburger Umland. Hier gab es am ehesten die Möglichkeit, Lebensmittel gegen wertvolle Schätze aus dem privaten Besitz einzutauschen. Allerdings war die „Vielfalt“ der Lebensmittel beschränkt: Kartoffeln, Porree und Steckrüben waren noch am ehesten zu bekommen.
Ein großes Problem bestand jedoch darin, ins Umland zu kommen. „Wenn man Glück hatte, erwischte man einen Zug mit den alten preußischen Dreiachser-Personenwaggons mit den zig Türen und am ganzen Waggon entlanglaufenden Trittbrettern“, schreibt Reuss. Eine andere Möglichkeit bestand darin, in offenen Güterwaggons zu fahren. Dort standen die Menschen eng gedrängt – bei Wind und Wetter.
Der Umgang der Engländer mit den Deutschen
Es sind vor allem die Kinder, die in den ersten Tagen der Besatzung unbefangen auf die englischen Soldaten zugehen „Wir lernten junge, zeitweise richtig lustige Soldaten in ihrer braunen Uniform nebst Käppi oder roter Tellermütze kennen“ erinnert sich Reinhard Reuss. Zumeist rauchten die Soldaten eine Zigarette nach der anderen. Manche der Deutschen hatten keine Hemmung, „halb aufgerauchte Zigaretten aufzuheben und unter den Augen der Briten weiterzuqualmen. Die lachten und fanden das Schauspiel dieser Art von Erniedrigung höchst amüsant.“
Grundsätzlich aber war – zumindest in den ersten Wochen und Monaten der Besatzungszeit – der Umgang der englischen Soldaten mit den Deutschen im Alltag eher distanziert. Das hatte seinen Grund in einem sogenannten Fraternisierungsverbot. Kontakte zwischen englischen Soldaten und den Deutschen sollten möglichst schon im Keim erstickt werden.
Um das den Deutschen zu erklären, richtete sich der britische Oberbefehlshaber Bernard Law Montgomery am 11. Juni 1945 eine Botschaft an sie. Darin begründet er, warum englische Soldaten den Deutschen nicht zuwinken oder mit deren Kindern spielen. Die Deutschen hätten den Krieg verloren und man wolle ihnen „eine endgültige Lehre“ erteilen, sagte Montgomery.
Die Deutschen seien nicht nur besiegt, sondern auch an dem Ausbruch des Krieges schuldig. „Darum stehen unsere Soldaten mit Euch nicht auf gutem Fuße. Dies haben wir befohlen, dies haben wir getan, um Euch, Eure Kinder und die ganze Welt vor noch einem Krieg zu bewahren.“
Die Botschaft endet mit dem Aufruf: „Dies sollt Ihr Euren Kindern vorlesen, wenn sie alt genug sind, und zusehen, dass sie es verstehen. Erklärt Ihnen, warum englische Soldaten sich nicht mit ihnen abgeben.“
Allerdings hielten die Engländer das Fraternisierungsverbot nicht lange durch. Schon einen Tag später, am 12. Juni 1945, wurden den englischen Soldaten erlaubt, mit deutschen Kindern zu sprechen. Gut einen Monat, am 14. Juli 1945, sagte Montgomery: „Die alliierte Politik der Austilgung des Nationalsozialismus und der Entfernung der Nationalsozialisten aus verantwortlichen Stellen des deutschen öffentlichen Lebens hat große Fortschritte gemacht. Es erscheint daher wünschenswert und an der Zeit, allen Angehörigen der britischen Streitkräfte in Deutschland zu gestatten, sich auf der Straße und in der Öffentlichkeit mit erwachsenen Deutschen zu unterhalten.“
1946 sei für die englischen Militärs auch das Eheverbot mit deutschen Frauen aufgehoben worden, schreibt Hohlbein. „Bis zum 10. Mai 1947 haben dann 3633 britische Soldaten um Genehmigung zur Heirat einer Deutschen nachgesucht.“ Dazu beigetragen hat wohl auch, dass schon im Juli die ersten kulturellen Veranstaltungen erlaubt wurden: in der Hamburger Musikhalle gab es wieder Konzerte zu hören und im Savoy-Theater – den heutigen Kammerspielen – die ersten Theaterstücke nach dem Krieg zu sehen.
Als problematisch erwies sich das von den Engländern ausgesprochen Verbot, feldgraue Uniformen und militärischer Kopfbedeckungen zu tragen. Vor allem für ehemalige Soldaten, die aus der Kriegsgefangenschaft entlassen worden waren und oft nichts weiter als ihre Uniform besaßen, stellte das ein großes Hindernis dar. Man behalf sich im Verlauf der Monate damit, die Uniformen blau oder braun zu färben.
Im Umgang mit den englischen Dienststellen hatten in den ersten Nachkriegstagen jene einen Vorteil, die die englische Sprache beherrschten. Die englischen Dienststellen wiesen nämlich jeden Antrag zurück, der nur in deutscher Sprache vorgelegt wurde.
Lesen Sie weiter: Das halbe Hamburg ist zerstört